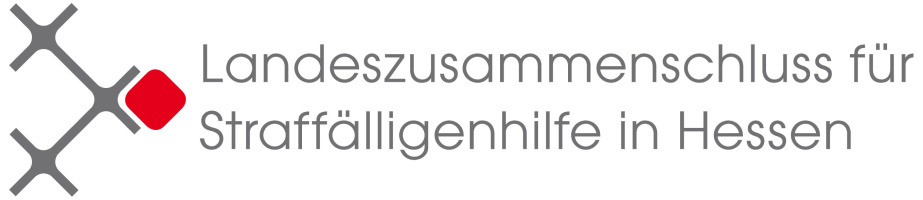Der Landeszusammenschluss für Straffälligenhilfe in Hessen hat die derzeit im Landtag vertretenen demokratischen Parteien im März 2023 gebeten, auf die folgenden Wahlprüfsteine zu antworten. Bis Mitte August 2023 haben geantwortet: Die Linke, CDU, SPD und FDP.
Die Antworten der Parteien zu den jeweiligen Themen werden unter dem Text des Wahlprüfsteins zusammengestellt. Aus Gründen der paritätischen Darstellung wechselt die Reihenfolge der Parteien ab. Im Anhang befinden sich die Antworten der Parteien im Zusammenhang.
Stand: August 2023
Redaktionelle Bearbeitung: Kornelia Kamla, 1. Vorstitzende
Der Landeszusammenschluss für Straffälligenhilfe in Hessen fragt zum Thema:
- Haftvermeidung und alternative Sanktionen
Die Ersatzfreiheitsstrafe aufgrund nicht gezahlter Geldstrafen trifft besonders häufig arme Menschen. Das zugrundeliegende Delikt ist oft von geringer Bedeutung und die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe eine vergleichsweise schwerwiegende Sanktion. Der Landeszusammenschluss für Straffälligenhilfe in Hessen setzt sich daher für eine Reform der Vollstreckung von Geldstrafen und der dazugehörigen Verfahren ein.
- Welche Handlungsoptionen sehen Sie in den Fragen rund um die Problematik der Ersatzfreiheitsstrafe?
- Unterstützen Sie die Entwicklung und Förderung von alternativen Sanktionen und die Diskussion von Alternativen zu Sanktionen?
- Wie gewährleisten Sie, dass die Beratung von Personen, die ihre Geldstrafe nicht bezahlen, sichergestellt wird?
Die Antworten der Parteien:
DIE LINKE HESSEN
Die Ersatzfreiheitsstrafe im deutschen Strafrecht ist in ihrer aktuellen Konzeption und ihrer praktischen Anwendung ein Instrument der Diskriminierung von einkommens- und vermögensschwachen Menschen, die häufig am Existenzminimum leben.
Wir wollen die Regelungen zur Ersatzfreiheitsstrafe im Strafgesetzbuch ersatzlos
streichen. Durch eine neue bundesgesetzliche Regelung soll stattdessen die gemeinnützige Arbeit gestärkt werden, um eine Pfändung abwenden zu können. An Stelle einer uneinbringlichen Geldstrafe sollte mit Zustimmung des Verurteilten gemeinnützige Arbeit stehen. Ein Tagessatz könnten drei Stunden gemeinnütziger Arbeit entsprechen.
Ersatzfreiheitsstrafen werden in der Praxis überwiegend wegen Bagatelldelikten („Schwarzfahren“, Ladendiebstähle u. Ä.) gegen mittellose, erwerbslose bzw. mehrfach (durch Abhängigkeit, psychische Probleme, Wohnungslosigkeit etc.) belastete Personen verhängt. Auch daher ist es notwendig, Delikten zukünftig verstärkt mit sozialstaatlichen Maßnahmen zu begegnen statt mit Freiheitsentzug. Für die Betroffenen ist aus Resozialisierungsgesichtspunkten zudem eine kontinuierliche, professionelle soziale Begleitung sinnvoller als eine freiheitsentziehende Maßnahme. Wir brauchen deshalb auch umfassende landesfinanzierte Beratungsangebote und einen Rechtsanspruch auf eine entsprechende Beratung.
CDU
Eine konsequente Strafverfolgung in Hessen ist eines unserer zentralen politischen Anliegen. Wer gegen eine Strafnorm verstößt, macht sich strafbar und muss entsprechend den geltenden Rechtsnormen verfolgt werden. Für die Ausgestaltung der entsprechenden Normen des Strafrechts ist dabei der allein der Bund verantwortlich. Die Strafzumessung obliegt im Rahmen der Gesetze der richterlichen Unabhängigkeit. In bestimmten Fällen, z.B. in solchen der Bagatellkriminalität, kann von Strafe abgesehen werden. Das Strafgesetzbuch sieht außerdem nicht nur Freiheitsstrafen, sondern auch Geldstrafen vor.
Für den Mechanismus der sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe gibt es gute Gründe. Eine pauschale Befreiung von strafrechtlich angeordneten Geldstrafen wegen Zahlungsunfähigkeit würde den Strafanspruch des Staates unterwandern und rechtsstaatlichen Grundsätzen entgegenstehen. Bei der Ersatzfreiheitsstrafe handelt es sich um ein grundsätzlich sinnvolles Sanktionsinstrument.
Wir teilen allerdings die Auffassung, dass die Ersatzfreiheitsstrafe in möglichst wenigen Fällen zur Anwendung kommen sollte. Dies gilt besonders, da die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe weitreichende Folgen haben kann, wie z.B. den Verlust der Wohnung oder des Arbeitsplatzes. Die von der Bundesregierung angekündigte Überarbeitung des Sanktionsrechts, mit der unter anderem das Ziel verfolgt wird, dass weniger Menschen mit einer Ersatzfreiheitsstrafe belegt werden bzw. Ersatzfreiheitsstrafen halbiert werden, unterstützen und begleiten wir konstruktiv.
Hessen verfügt daher dank der CDU-geführten Landesregierung über ein bewährtes Modell zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen, das vertieft und durch eine finanzielle und ideelle Unterstützung der Träger vor Ort weitere Optimierung finden wird. Hierzulande wurde und wird unter der CDU- geführten Landesregierung viel unternommen, um Verurteilten die Möglichkeit zu geben, die einschneidenden Folgen der Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden.
Bereits sehr früh wurde das Projekt „Auftrag mit Antrag“ initiiert. Verurteilte können danach an die Vollstreckungsbehörden herantreten, um alternative Lösungen zur Tilgung der Geldstrafe zu finden. Selbst wenn ein Verurteilter auf ein Anschreiben der Vollstreckungsbehörde nicht reagiert, wird ein örtlicher Träger des Projekts beauftragt zu handeln, um eine Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden. Die Träger betreuen die Verurteilten und suchen gemeinsam mit ihnen nach Wegen, eine „goldene Brücke“ zu bauen, um die Geldstrafe zu tilgen. Alternative Tilgungsmöglichkeiten können z.B. eine Ratenzahlungsvereinbarung oder die Ableistung von gemeinnütziger Arbeit sein. Im Falle des Fehlens einer Wohnmöglichkeit kann zudem in der Zeit der Ableistung gemeinnütziger Arbeit Wohnraum bereitgestellt werden.
Das Strafrecht bietet bereits jetzt einen bunten Strauß an „Alternativen Sanktionen“. Bis es zu einer (Haft-)Strafe kommt, ist in der Regel ein weiter Weg zurückgelegt.
Alternative Sanktionen in dem Sinne, dass eine Vielzahl an Straftatbeständen ausschließlich zivilrechtlich reguliert oder pauschal entkriminalisiert werden, wie bspw. bei der Legalisierung von Drogen, halten wir nicht für sinnvoll. In Einzelfällen, bspw. bei §265a StGB (Erschleichen von Leistungen), wäre die Anpassung der Norm im Rahmen eines Entlastungskonzeptes für die Justiz eine Möglichkeit.
Auch der Einsatz von Therapien sollte weiterhin im Einzelfall bei entsprechenden Straftaten zielgerichtet und nicht als pauschaler Ersatz für Geld- bzw. Freiheitsstrafen eingesetzt werden.
Arbeit als Ersatz von Geld- bzw. Freiheitsstrafen sehen wir im Hinblick auf Art. 12 GG über das bereits derzeit normierte Maß hinaus kritisch.
SPD
Die Frage der Ersatzfreiheitsstrafen muss grundsätzlich auf Bundesebene geregelt werden. Aber prinzipiell ist aus unserer Sicht die heutige Form der Ersatzfreiheitsstrafe und deren Vollstreckung nicht geeignet, die zugrundeliegenden Delikte zu sanktionieren. Möglicherweise muss hier aber schon bei der Verhängung der ursprünglichen Geldstrafe angesetzt werden und bei einer Reformierung des Strafgesetzbuches über andere Sanktionsmaßnahmen, die eine Wiederholung der betreffenden Straftaten verhindern sollen, nachgedacht werden. Wir müssen die Justiz personell enorm verstärken, um zu verhindern, dass, wie derzeit, rund zwei Drittel der Geldstrafen im Strafbefehlsverfahren ausgeurteilt werden. Ein Richter, eine Richterin, die den Verurteilten nie gesehen hat, kann aus unserer Sicht keine angemessene Sanktion aussprechen. Bagatelldelikte, wie z.B. das sog. „Schwarzfahren“, müssen endlich aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen werden. Dafür setzen wir uns schon lange ein und haben auch die Landesregierung schon zu entsprechenden Bundesratsinitiativen aufgefordert, was allerdings mit der Regierungsmehrheit in Hessen abgelehnt worden ist. Ersatzfreiheitsstrafen treffen überwiegend arme Menschen – dies muss sich ändern.
Die Beratung von Personen, die ihre Geldstrafe nicht zahlen können, muss weiterhin durch die auskömmliche Finanzierung von Projekten (z. B. AoA) gesichert werden. Allerdings sollte diese Beratung zukünftig grundsätzlich nicht von dem guten Willen der Vollstreckungsabteilung der Staatsanwaltschaften abhängig sein und auch nicht erst erfolgen, wenn der Haftbefehl kurz bevorsteht. Sinnvoller wäre es, wenn grundsätzlich mit der Verhängung einer Geldstrafe bereits eine Beratung angeboten wird und spätestens nach der ersten fruchtlosen Mahnung eine aufsuchende Beratung erfolgen würde.
Und auch hier spielt nochmal die Art der Verurteilung eine Rolle. Insbesondere die Verhängung der Geldstrafen im Strafbefehlsverfahren muss, wie oben bereits erwähnt, überprüft werden, da Menschen, die z.B. grundsätzlich keine behördliche Post öffnen, oft gar nicht mitbekommen, dass sie verurteilt wurden.
FDP
Nach zehn gescheiterten Versuchen, die Ersatzfreiheitsstrafe zu reformieren, hat inzwischen der Deutsche Bundestag einem Gesetzentwurf zur Überarbeitung des Sanktionenrechts zugestimmt. Der Vorschlag unseres Bundesjustizministers Dr. Marco Buschmann stellt eine ausgewogene Lösung dar, die die repressive und präventive Wirksamkeit der Geldstrafe sichert und dabei zugleich die zum Teil schwerwiegenden Folgen einer Freiheitsstrafe auf das Berufs- und Privatleben der verurteilten Personen im Blick hat. Zukünftig entsprechen zwei Tagessätze Geldstrafe nur noch einem Tag Ersatzfreiheitsstrafe. Zudem setzen wir verstärkt auf die Möglichkeit, eine Ersatzfreiheitsstrafe durch gemeinnützige Arbeit zu ersetzen. Damit schaffen wir ein für alle faires Sanktionensystem. Betroffene müssen zudem in Zukunft ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen werden, dass sie alternativ zur Haft auch soziale Arbeit zugunsten der Allgemeinheit verrichten können. In diesem Zusammenhang hat auch eine Beratung der Personen zu erfolgen, denen die finanziellen Mittel zur Zahlung der Geldstrafe fehlen. Eine komplette Streichung der Ersatzfreiheitsstrafen lehnen wir hingegen ab. Dies würde die „wirksame Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs“ bei der Geldstrafe grundsätzlich infrage stellen.
Der Landeszusammenschluss für Straffälligenhilfe in Hessen fragt zum Thema:
- Rechtsanspruch auf Hilfe
Die Hilfeleistungen für straffällig gewordene Menschen ergeben sich aus einer Vielzahl verschiedener Gesetze und Verordnungen. Um sie zu bündeln und zu sichern, fordert der Landeszusammenschluss für Straffälligenhilfe ein Resozialisierungsgesetz, das auch die an den Bedarfen ausgerichtete Ausgestaltung der Straffälligenhilfe und ihre ausreichende Finanzierung sicherstellen soll.
- Unterstützen Sie die Einführung eines Resozialisierungsgesetzes, wie es bereits in anderen Bundesländern vorhanden ist?
- Wenn ja, welche Schritte erachten Sie für dieses Vorhaben als wirksam?
- Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um die ressortübergreifende Zusammenarbeit von Justiz und Sozialem zu verbessern und zu befördern?
Die Antworten der Parteien:
CDU
Eine gute Resozialisierung der Gefangenen ist aus Sicht der CDU Hessen zentrales Ziel des Strafrechts. Je besser die Resozialisierung gelingt, umso geringer fällt die Wahrscheinlichkeit der Begehung neuer Straftaten aus und umso besser ist die Lebensperspektive des Strafgefangenen nach Ende seiner Strafe.
Hessen verfügt über moderne Strafvollzugsgesetze, die in der letzten Legislaturperiode evaluiert und dadurch noch passgenauer an dem Gedanken der Resozialisierung ausgerichtet wurden. Die vorhandenen Gesetze nehmen die möglichen Inhalte eines „Resozialisierungsgesetzes“ insofern auf - für ein danebenstehendes eigenes „Resozialisierungsgesetz“ besteht aus Sicht der CDU Hessen derzeit kein Bedarf.
Zur Verwirklichung des Resozialisierungsgedankens ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden und begleitenden, beratenden und eingliedernden Angeboten, die zumeist im Bereich der sozialen Hilfen angesiedelt sind, anzustreben. Diese Zusammenarbeit wird zwischen den zuständigen Behörden täglich gelebt. Insbesondere die zielgerichtete Zusammenarbeit bspw. im Bereich der Häuser des Jugendrechts, im Bereich der Resozialisierung und Unterstützung im Strafvollzug, der Sozialen Dienste oder der Jugendgerichtshilfe sind gute Beispiele für ein sinnvolles Zusammenwirken.
Die enge, vertrauensvolle und zielgerichtete Zusammenarbeit zwischen den Ressorts und auch zwischen den verschiedenen Behörden in Hessen ist für die CDU-geführte Landesregierung elementar und kann als sehr erfolgreich bewertet werden. Darüber hinausgehende Intensivierungen – auch konkret im Hinblick auf die Ressortzusammenarbeit, etwa in Form von Arbeitsgruppen oder eines institutionalisierten Erfahrungsaustauschs der Fachbeamtinnen und Fachbeamten – sind selbstverständlich immer sinnvoll und werden von uns vollumfänglich unterstützt.
SPD
Wir unterstützen die Einführung eines Resozialisierungsgesetztes (welchen Namen es tragen wird steht allerdings noch nicht fest) und arbeiten bereits an einem Entwurf. Wir werden spätestens in der nächsten Legislaturperiode einen Gesetzesentwurf vorlegen, der dann auch den betroffenen Fachleuten zur Anhörung vorgelegt wird. Die Arbeit im Bereich der Straffälligenhilfe und der Resozialisierung muss besser koordiniert und Erschwernisse in der Praxis (z. B. durch fehlenden Zugriff auf Informationen oder Zugänge zu Datensystemen) müssen abgebaut werden. Dies kann nur durch eine gesetzliche Regelung erfolgen. Auch die Verzahnung der Justiz mit den betreuenden (sozialen) Berufen muss durch eine engere Zusammenarbeit und einen regelmäßigen Austausch verbessert werden. Hier spielt ebenfalls der Datenschutz eine Rolle, der gesetzlich so geregelt werden muss, dass die sinnvolle ineinandergreifende behörden- und einrichtungsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Justiz und Straffälligenhilfe in der Praxis funktioniert.
FDP
Für eine gelungene Resozialisierung möglichst vieler Ex-Strafgefangener müssen moderne und kreative Konzepte geschaffen und umgesetzt werden. Der offene Vollzug ist zu intensivieren, um die Rückfallquoten zu reduzieren. Die öffentliche Sicherheit muss dabei stets gewährleistet sein. Die Begleitung der Gefangenen nach der Haftentlassung und die Vorbereitung zur Haftentlassung müssen verbessert werden. Ansonsten kann Resozialisierung nicht gelingen.
Wir wollen spezifische Fort- und Weiterbildungsangebote für Vollzugsbedienstete entwickeln: zum einen für die persönliche Weiterentwicklung und zum anderen, um die Gefangenen bei ihrer Resozialisierung bestmöglich unterstützen zu können.
Ein Beispiel für ein gelungenes Zusammenspiel zwischen Sozialem und der Justiz stellt aus Sicht der Freien Demokraten zweifellos die JVA Fulda dar. Die Anstalt arbeitet sehr eng mit der Stadt, der Caritas und lokalen Akteuren zusammen, um den entlassenen Inhaftierten einen guten Start in ihr Leben in Freiheit zu ermöglichen. Dieser Prozess des Übergangsmanagements beginnt sechs Monate vor der geplanten Freilassung und endet spätestens sechs Monate nach der Freilassung. Während der Zeit in Haft werden hierbei sämtliche Lebensbereiche der Inhaftierten besprochen und ganzheitlich vorbereitet. Nach der Entlassung steht das Übergangsmanagement den Inhaftierten sechs weitere Monate als Ansprechpartner zur Verfügung. Für die JVA besteht nach der Entlassung zwar kein Anspruch
darauf, dass dieses Angebot wahrgenommen wird, dennoch ist dies bei den ehemaligen Inhaftierten sehr oft der Fall.
Aus Sicht der Freien Demokraten sollten Vereine, die sich im Vollzugsbereich engagieren, stärker in den Vollzugsalltag integriert werden. So existieren bereits Vereine, die zum Ziel haben, Kinder von Inhaftierten als eine eigenständige Zielgruppe mit spezifischen Bedürfnissen wahrzunehmen und ihnen dabei zu helfen, entsprechenden Unterstützungsbedarf einzufordern und zu erhalten. (Kinder im Mittelpunkt – seit 2023 „Netzwerk Kinder von Inhaftierten Hessen“ Netzwerk Kinder von Inhaftierten Hessen | AKTION - Perspektiven für junge Menschen und Familien e.V. (aktion-verein.org)) In diesem Bereich wollen wir die Zusammenarbeit der Vollzugsanstalten mit bestehenden Projekten forcieren.
DIE LINKE HESSEN
Wir unterstützen Reformbestrebungen im Bereich des Justizvollzugs. Wir brauchen eine echte Resozialisierung. Hierfür ist eine ausreichende Personalausstattung im Vollzug notwendig ebenso wie ein breites Spektrum an Fachkräften sowie eine gute und verpflichtende Vernetzung mit den Sozialbehörden wie auch den Organisationen, Einrichtungen und Verbänden der freien Straffälligenhilfe notwendig. Insbesondere die Personalausstattung ist aktuell nicht gewährleistet. Aber nicht nur Inhaftierte, sondern auch alle zu Bewährungsstrafen oder Geldstrafen Verurteilten brauchen ein zuverlässiges Beratungsangebot, das niedrigschwellig zu erreichen und vom Land finanziert werden muss. Dies alles sollte in einem Resozialisierungsgesetz geregelt werden.
Der Landeszusammenschluss für Straffälligenhilfe in Hessen fragt zum Thema:
- Wohnraumsicherung und -bereitstellung als notwendige Voraussetzung der Wiedereingliederung von Inhaftierten und Haftentlassenen
Ein Dach über dem Kopf ist unabdingbar für die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Haftentlassene und die Klientel der Bewährungshilfe benötigen bezahlbaren Wohnraum, ggf. mit Betreuungsangeboten. Für Inhaftierte in Untersuchungshaft muss vorhandener Wohnraum gesichert werden.
Gerade in den Ballungszentren, in denen eher Arbeitsmöglichkeiten bestehen und ein Hilfesystem vorhanden ist, steht zu wenig bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung. Der Landeszusammenschluss fordert einen deutlichen Ausbau des sozialen Wohnungsbaus und setzt sich für die Entwicklung neuer Ansätze zur Beschaffung und Sicherung von Wohnraum ein, beispielsweise flächendeckende Etablierung von sozialen Wohnraumhilfen.
- Welche Ideen und Maßnahmen verfolgen Sie zum Wohnraumerhalt während der Inhaftierung und zur Bereitstellung von Wohnraum nach Haft?
Die Antworten der Parteien:
SPD
Mangelnder Wohnraum ist ein generelles Problem, mit dem wir uns schon längere Zeit beschäftigen. Allerdings ist es richtig, dass Haftentlassene auf dem Wohnungsmarkt besonders schlechte Chancen haben. Auch die in vielen Orten vorhandenen Wohnraumhilfevereine stoßen bereits an Grenzen bei der Vermittlung von Wohnungen. Dennoch müssen diese Beratungsstellen gestärkt und bei der Beschaffung von Überganswohnungen unterstützt werden. Gerade Anzahl und Verfügbarkeit von kleinen und günstigen Wohnungen stellen ein Problem dar, welches auf Bundes- und Landesebene mit aller Kraft angegangen werden muss. Insbesondere die Förderung des sozialen Wohnungsbaus werden wir vorantreiben.
Die Errichtung von Wohnheimen für Haftentlassene halten wir allerdings nicht für zielführend. Dies wirkt einer Integration in die Gesellschaft eher entgegen.
Für die Übernahme der Mietkosten während einer (kurzen) Haftstrafe durch das Sozialamt kommt es derzeit auf den Einzelfall an, und müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Dies ist sicher nicht befriedigend und fördert nicht die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Eine Änderung der Sozialgesetzgebung muss aber auf Bundesebene erfolgen. Wir werden uns dafür einsetzen.
FDP
Wohnen gehört zu den existenziellen Grundbedürfnissen der Menschen. Dies gilt auch und gerade für Inhaftierte, bei denen Resozialisierung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft nur dann gelingen können, wenn nach der Haftzeit Wohnraum zur Verfügung steht. Eine soziale und liberale Ordnung nützt allen Mitgliedern der Gesellschaft. Für uns Freie Demokraten bedeutet das auch, dass die Starken der Gesellschaft die Schwachen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Freiheit der Persönlichkeit und Wahrung der Menschenwürde sind die Grundlagen des Liberalismus. Sie dürfen nicht am Wohnungsmarkt scheitern. Eine Wohnung gibt dem Leben des Menschen Halt und Würde. Ein festes Zuhause ist eine der Grundlagen unserer Gesellschaft. Uns Freien Demokraten ist daran gelegen, die vielschichtigen Probleme im Bereich der Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit in deutschen Städten aktiv anzugehen. Dies bedeutet auch Niemanden zurückzulassen, auch Strafgefangene nicht. Biografien und Lebenswege verlaufen nicht immer gradlinig – es ist Teil unseres Menschenbildes, Menschen zu befähigen, sich wieder selbst zu helfen, wenn sie in Schwierigkeiten geraten sind. Dazu brauchen sie Beratungsangebote wie Schuldnerberatung, Straffälligenhilfe, Housing-First- Wohnprojekte und andere innovative Projekte, zum Teil ergänzt um digitale Angebote.
Wohnraum zu finden ist für diese Menschen noch schwieriger als ohnehin schon – wir wollen sie dabei unterstützen. Dazu möchten wir unter anderem eine umfassende Vernetzung der Beteiligten der Wohnungswirtschaft wie der Beratungs- und Unterstützungsstrukturen erreichen.
Die Kommunen sind vor Ort die nächsten Ansprechpartner für die Menschen und tragen dafür Sorge, diesen dabei zu helfen, die Gründe für Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu überwinden, ihre Wohnung zu halten oder in letzter Instanz mit Obdach zu versorgen. Insbesondere können Sie auf kurzem Wege lokale Informationen mit allen zuständigen Ämtern teilen. Gerade die kommuneninterne Kommunikation ist auf Grund der Vielschichtigkeit der Gründe für Wohnungs- und Obdachlosigkeit enorm wichtig. Schon jetzt wird das Sozialgericht informiert, wenn eine Person zwangsgeräumt wird. Wir wollen eine ähnlich gelagerte einheitliche Meldepflicht und Vernetzung aller Träger der Leistungen nach Sozialgesetzbuch, um gemeinsam die Menschen dabei zu unterstützen, die Gründe des Wohnungsverlustes nachhaltig aufzulösen, auch im Zusammenhang mit einer verbüßten Freiheitsstrafe. Hinzu kommen zuständige Ämter und zivilgesellschaftliche Akteure, insbesondere hier das Gesundheitsamt auf Grund des hohen Zusammenhangs mit psychischen Verletzungen und Traumata und die vielen lokalen Partner wie karitative Träger, Wohnungsbaugesellschaften und auch den privaten Vermietern. Die Kommune hat eine entscheidende Bedeutung als Vermittler, Kümmerer und Kommunikationsplattform vor Ort. Genauso sind die Kommunen in letzter Instanz für die polizei- und ordnungsrechtliche Unterbringung von Wohnungs- und Obdachlosen zuständig, wenn alle Möglichkeiten nicht wirkten, die eigene Wohnung zu halten, oder der Mensch schon länger sein Zuhause verloren hatte. Wir Freie Demokraten wollen auch weiterhin diese Kompetenzen bei den Kommunen erhalten. Deshalb setzen wir uns für eine Finanzierung der Kommunen ein, die dieser Bedeutung gerecht wird. Nur lokal vor Ort und mit dem Wissen um die jeweilige lokale Situation kann angemessen, effektiv und vor allem dem Einzelfall entsprechend entschieden werden, was der jeweils beste Weg ist. Das gilt sowohl für die Zusammenarbeit mit den Betroffenen, als auch für die Kommunen selbst, denn nur sie wissen am besten, welche Möglichkeiten sie vor Ort haben und welche Unterstützung sie als Kommune benötigen. Des Weiteren wollen wir im Rahmen der statistischen Erhebung und der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen in Erfahrung bringen, warum bisherige ineffektive und für die betroffenen Menschen nicht hilfreiche Strukturen nach wie vor bestehen und wo und wie Anreize geschaffen werden können, bürokratische Schleifen zu durchbrechen.
Dementsprechend erkennen wir Freie Demokraten an, dass manche Kommunen Unterstützung bedürfen und ebenso manche Aufgaben nur sinnvoll auf Länder- oder Bundesebene, wie zum Beispiel die statistische, einheitliche Erfassung, gelöst werden können. Wir wollen gemeinsam mit den Kommunen und den Ländern nach dem Subsidiaritätsprinzip arbeiten und flexible Lösungen und Hilfeleistungen entwickeln und umsetzen.
DIE LINKE HESSEN
Wir setzen uns für ein Recht auf Wohnen ein – für alle. Das heißt auch: Es darf keine Entlassung in die Obdachlosigkeit geben. Auch hierfür treiben wir den sozialen Wohnungsbau voran. Solange die Haftzeit unter einem Jahr bleibt, sollte es selbstverständlich sein, dass die Wohnung erhalten bleibt. Das bedeutet, dass wenn die Kosten nicht selbst getragen werden können, diese unbürokratisch finanziert werden bzw. eventuell eine Zwischenmiete organisiert wird. Dies umso mehr während einer Untersuchungshaft, auch wenn diese länger als ein Jahr andauert.
CDU
Die Wiedereingliederung Inhaftierter in die Gesellschaft nach ihrer Haftentlassung ist ein wesentlicher Bestandteil des modernen Justizvollzugs. Der hessische Justizvollzug stellt dafür umfassende und individuelle Angebote zur Verfügung. Diese Angebote reichen von Schul-, Aus- und Weiterbildungsangeboten, kulturellen und sportlichen Angeboten, bis zu Drogen-, Ausländer- und Schuldnerberatungen während der Inhaftierung.
Außerdem hat die CDU-geführte Landesregierung in dieser wie in vorherigen Legislaturperioden mehrere Projekte, Träger und privatrechtlich organisierte Vereine finanziell unterstützt, die Gefangenen Hilfestellungen bei der Wiedereingliederung bieten. Die Hilfestellung betrifft auch Fälle, in denen die Wiedereingliederung von Verurteilten zum Beispiel durch eine schwierige Suche nach Wohnraum behindert wird.
Aufbauend auf dem hessischen Sozialbudget werden wir FDP die sozialpolitischen Maßnahmen künftig in einem Zukunftsfonds „Hessen steht zusammen“ bündeln und auf 150 Millionen Euro erhöhen. Damit schaffen wir Verlässlichkeit, Planungs- und Zukunftssicherheit für die Menschen, Vereine und Verbände, die anderen Sicherheit und Hilfe geben. In diesem Zusammenhang werden wir die finanzielle Unterstützung weiterführen und ausbauen.
Der Landeszusammenschluss für Straffälligenhilfe in Hessen fragt zum Thema:
- Familienorientierter Strafvollzug: Angehörige als Zielgruppe der Straffälligenhilfe
Angehörige tragen die Konsequenzen einer Inhaftierung mit. So ergeben sich häufig psychische, soziale und materielle Probleme, von denen vor allem Frauen und Kinder betroffen sind. Für sie müssen spezifische Beratungs- und Unterstützungsangebote vorgehalten und weiterentwickelt werden.
Besonderes Augenmerk sollte auf die Kinder Inhaftierter gelegt werden. Im Sinne des Kindeswohls muss der Vollzug einen kindgerechten Kontakt zwischen den Kindern und ihrem inhaftierten Elternteil fördern. Der Eltern-Kind-Vollzug ist zu stärken und insofern weiterzuentwickeln, dass auch Vater-Kind-Vollzug in Hessen möglich wird.
Die Straffälligen sind als Teil ihrer Familie wahrzunehmen und die innerfamiliären Beziehungen zu stärken. Im Vollzug ist sicherzustellen, dass eheliche bzw. partnerschaftliche und familiäre Beziehungen aufrechterhalten oder wiederhergestellt werden können und mögliche Trennungen beratend begleitet werden.
- Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um den Vollzug von Müttern und Vätern kindgerechter zu gestalten?
- Wie könnte Vollzug für Eltern vermieden oder verkürzt werden, um schädliche Folgen zu verhindern?
Die Antworten der Parteien:
FDP
Die Orientierung von Gefangenen an ihren Familien, erhöhen sich die Chancen auf eine spätere Resozialisierung und ist somit unverzichtbar. Die Unterstützung der Familienorientierung wird durch die Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und verlängerter Besuchszeiten erreicht. Zudem fordern wir, in konfliktbelasteten Familien durch entsprechende Gesprächs- und Trainingsangebote Klärungsprozesse in Gang setzen bzw. auf getrennte Lebensperspektiven vorbereiten. Auch die auf diesem Gebiet tätigen Vereine und Verbände sind finanziell auskömmlich zu unterstützen, damit diese Form der Hilfsangebote erhalten bleibt. Allerdings ist es dem Strafanspruch des Staates immanent, dass eine durch unabhängige Gerichte verhängte Haftstrafe auch zu Nachteilen in Bezug auf das familiäre Leben führt. Die Elternschaft als solche kann daher im Ergebnis nicht zu einer Vermeidung einer Haftstrafe führen.
DIE LINKE HESSEN
Kontakt zum inhaftierten Elternteil ist für betroffene Kinder weit mehr als die Chance, besser mit der Belastung zurechtzukommen: Er ist ein Menschenrecht, das von Seiten der Gesetzgebung zu achten, zu respektieren und zu verwirklichen ist. Das Recht der Kinder auf Kontakt mit ihren Eltern muss endlich ernst genommen werden. Unbegrenzte Telefonie mit den Kindern und Sonderbesuchszeiten für die Kinder in kindgerechter Umgebung, die in deren Tagesablauf passen, sind unabdingbar, um nicht auch die Kinder mit zu bestrafen. Ein konsequent auf Resozialisierung ausgerichteter, gut ausgestatteter Vollzug, der soweit möglich den offenen Vollzug nutzt, ermöglicht es, Inhaftierte und so auch Eltern, gut resozialisiert frühzeitig zu entlassen. Die Inhaftierung sollte generell ultima ratio sein.
CDU
Eine Haftstrafe ist mit einschneidenden Belastungen für die Verurteilten verbunden. Dies ist leider unvermeidlich, damit Strafe ihren Zweck erfüllen kann.
Gleichzeitig kommt für uns als CDU Hessen dem Wohl der Kinder stets die höchste Priorität zu. Besonderes Augenmerk ist daher darauf zu legen, dass Kinder der Verurteilten dies nicht als nachhaltig negativ einschneidendes Erlebnis wahrnehmen.
Bereits gegenwärtig gibt es mit Blick auf die gesetzlichen Grundlagen ein flexibles Bündel von Eltern-Kind-Angeboten sowie Maßnahmen zur Einbeziehung des Eltern- und Familiengedankens in der Strafe. Neben weitgehenden quantitativen wie qualitativen Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich des Besuchs (z.B. durch Familiensonderbesuche, das Projekt „Mutter- Kind-Tage, Familienfreizeit“ etc.), mit denen die familiären Kontakte gefördert und gestärkt werden können, kann bei entsprechender Eignung von Gefangenen im jeweiligen Einzelfall auch durch die Gewährung vollzugsöffnender Maßnahmen bis hin zur Möglichkeit des Familienfreigangs sowohl den familiären Bedürfnissen wie auch dem Kindeswohl umfassend Rechnung getragen werden. Von solchen Angeboten und Maßnahmen wird gerade in der Frauenvollzugsanstalt und in den Mutter-Kind-Heimen reger Gebrauch gemacht.
Für straffällig gewordene Mütter hat die CDU-geführte Landesregierung ein Mutter-Kind-Heim geschaffen, welches in der Frauenanstalt JVA Frankfurt am Main III betrieben wird. Dieses ist beispielhaft geeignet, die negativen Folgen der Haft auf die Kinder bestmöglich aufzufangen. In diesem Mutter- Kind-Heim bewohnen die Inhaftierten jeweils gemeinsam mit ihren Kindern ein Zimmer, das sich in einer Wohngruppe mit höchstens fünf Inhaftierten befindet. Neben den Wohnräumen besteht die Wohngruppe aus einem Spieleraum, einer gemeinsamen Küche mit Essbereich und einem Spielplatz auf dem Außengelände. Während der Arbeits- und Ausbildungszeit der inhaftierten Frauen werden die Kinder durch Erzieherinnen und Erzieher in der angrenzenden Kindergruppe betreut. An den Wochenenden gibt es zudem Mutter-Kind-Angebote zur Freizeitgestaltung. Den Frauen wird so ermöglicht, eine stabile Bindung zu ihrem Kind aufrechtzuerhalten. Die Mütter sollen zudem in die Lage versetzt werden, ihr Leben und die Erziehung des Kindes während und nach der Haft zu bewältigen. Auch der Kontakt mit Vätern ist in dem Mutter-Kind-Heim räumlich wie konzeptionell grundsätzlich möglich.
SPD
Die Inhaftierung eines Familienangehörigen ist für die Familie immer ein tiefer Einschnitt. Sind in der Familie kleine Kinder vorhanden, ist dies besonders schlimm. Wir werden daher die Familien durch Ehrenamtsprojekte, wie dies schon im Bereich der Bewährungshilfe erfolgreich läuft, unterstützen und Beratungsstellen fördern.
Innerhalb des Strafvollzugs muss es, wo dies unter Beachtung der Sicherheitserfordernisse möglich ist, mehr Kontaktmöglichkeiten von Kindern mit dem inhaftierten Elternteil geben. Diese müssen dann aber auch sozialpädagogisch begleitet (vor- und nachbereitet) werden. Ob es Möglichkeiten gibt, neben dem Mutter-Kind-Vollzug auch einen Vater-Kind-Vollzug zu verwirklichen muss geprüft werden. Hierbei sind sowohl vollzugsorganisatorische Fragen, als auch Fragen des Kindeswohls zu berücksichtigen. Insbesondere ist zu prüfen sowie in Anhörungen und fachlichem Austausch zu erörtern, inwiefern ein solcher Vollzug auch bei schulpflichtigen Kindern möglich und sinnvoll bzw. ein diesbezüglicher Rechtsanspruch umsetzbar ist.
Nicht zuletzt sehen wir auch in Freigang zur Betreuung von Kindern ein probates Mittel, die Bindung zwischen Eltern und ihren Kindern zu erhalten. Wo es der Einzelfall gestattet, ist aus unserer Sicht der Freigang zur Betreuung zu stärken.
Ob und inwiefern ein Vollzug für Eltern vermieden werden kann, hängt natürlich vordringlich von dem verwirklichten Delikt und weiteren Faktoren ab. Allein die Elternschaft kann nicht zu einer Haftverschonung führen, auch wenn davon negative Auswirkungen auf die Familie zu erwarten sind. Eine Ungleichbehandlung von Eltern und Kinderlosen kann es grundsätzlich nicht geben.
Der Landeszusammenschluss für Straffälligenhilfe in Hessen fragt zum Thema:
- Wiedereingliederung und Teilhabe
Der erfolgreichen Wiedereingliederung straffällig gewordener Menschen stehen viele Hindernisse im Weg. Vollzugsöffnenden Maßnahmen sind stark reduziert worden und Vorbestrafte werden meist skeptisch von ihren Mitmenschen betrachtet und sie verbleiben zu oft am Rand der Gesellschaft.
- Wie möchten Sie die gesellschaftliche Wiedereingliederung und Teilhabe von Haftentlassenen verbessern?
- Haben Sie Ideen, wie die Entlassungsvorbereitung von Inhaftierten weiter ausgebaut werden könnte?
Die Antworten der Parteien:
DIE LINKE HESSEN
Die Abkehr vom offenen Vollzug und der restriktive Umgang mit vollzugsöffnenden Maßnahmen sind völlig falsche Wege. Resozialisierung kann nicht isoliert hinter den Mauern stattfinden. Der offene Vollzug muss die Regel sein. Klar muss sein, dass nicht die Bediensteten dafür haften, wenn es während der vollzugsöffnenden Maßnahmen zur Delinquenz kommt.
CDU
Siehe oben, wurde gemeinsam beantwortet mit dem Punkt
Wohnraumsicherung und -bereitstellung als notwendige Voraussetzung der Wiedereingliederung von Inhaftierten und Haftentlassenen
SPD
Die Wiedereingliederung von straffällig gewordenen Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und muss als solche auch mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Ein erster Schritt sind die Ehrenamtsprojekte in der Bewährungshilfe, die weiter ausgebaut und unterstütz werden müssen. Zudem müssen wir uns genau anschauen, aus welchen Gründen der offene Vollzug und andere vollzugsöffnende Maßnahmen zurückgegangen sind und müssen hier gegensteuern. Wir brauchen auch mehr Einrichtungen außerhalb der Vollzuganstalten, die die Haftentlassenen bei ihrer Wiedereingliederung unterstützen. Wir haben viel zu wenig betreute Wohneinrichtungen, die die Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags unterstützen können. Viele Haftentlassene sind aber überfordert mit der Organisation des „ganz normalen“ Lebens. Die derzeitige Situation auf dem Wohnungsmarkt macht es für Haftentlassene besonders schwierig, geeigneten Wohnraum zu finden. Hier muss eine generelle Entlastung des Wohnungsmarktes durch den vermehrten Bau von öffentlich geförderten Wohnungen erfolgen. Dies hätte auch auf die Situation der Haftentlassenen positive Auswirkungen. Spezielle Wohneinrichtungen, in denen dann die Haftentlassenen untergebracht werden, halten wir nicht für zielführend, da dadurch eine Absonderung und keine Integration erfolgt.
Die Entlassungsvorbereitung in der JVA muss einen nahtlosen Übergang zu unterstützenden Maßnahmen außerhalb der Anstalt bewirken. So sollten schon in der JVA die Kontakte zu möglichen ehrenamtlichen Unterstützer*innnen für die Zeit nach der Entlassung geknüpft werden und so eine lückenlose Betreuung gewährleistet werden. Entlassungen an einem Freitagnachmittag darf es nicht mehr geben. Die Haftentlassenen müssen unmittelbar nach der Entlassung die Möglichkeit haben, Behörden aufzusuchen (möglichst mit ehrenamtlicher Unterstützung) und Anträge zu stellen.
Ein weiteres Hindernis für die Haftentlassenen ist häufig eine hohe Verschuldung, die nach der Entlassung wieder voll über sie hineinbricht. Wir werden noch größeren Wert auf die Schuldnerberatung in der JVA legen und auch hier muss eine weitere Betreuung außerhalb der JVA gewährleistet werden und die Überlastung der Beratungsstellen abgebaut werden.
FDP
Wir Freien Demokraten fordern ein flächendeckendes Übergangsmanagement an allen hessischen Justizvollzugsanstalten. Dieses Übergangsmanagement muss die Vermittlung in Wohnraum ebenso zum Gegenstand haben, wie die Sicherung der materiellen Existenz, die berufliche Integration und auch die soziale Integration. Hierbei wollen wir uns beispielhaft am Übergangsmanagement der JVA Fulda orientieren, das allerdings noch nicht in allen Vollzugsanstalten etabliert ist. Außerdem wollen wir die vorhandenen Angebote, die auf Resozialisierung ausgerichtet sind und diverse Aus- und Weiterbildungsangebote, sowie kulturelle und sportliche Angebote umfassen weiter ausbauen. Für entsprechend qualifizierte Inhaftierte muss dies auch eine Förderung zum Zweck des Zgang zu einem Studium beinhalten.. Bisher vorliegende Anträge von Inhaftierten haben bislang noch nicht zur tatsächlichen Aufnahme eines Studiums geführt.
Ziel muss insgesamt auch eine auskömmliche Ausstattung mit qualifiziertem Personal sein, da die Erfahrung zeigt, dass viele grundsätzlich vorhandene Angebote an einer personellen Unterbesetzung scheitern.
Der Landeszusammenschluss für Straffälligenhilfe in Hessen fragt zum Thema:
- Offener Vollzug als Regel
Es ist offenkundig, dass die Reintegration in die Gesellschaft aus dem offenen Vollzug besser und nachhaltiger gelingt als aus geschlossenen Anstalten. In Fällen, in denen der Rechtsgüterschutz dies nicht zulässt, gilt es, vollzugsöffnende Maßnahmen stärker zur Vorbereitung der Haftentlassung zu nutzen.
- Planen Sie die verstärkte Nutzung des offenen Vollzuges? Wie können Vollzugsanstalten bei der Gewährung von vollzugsöffnenden Maßnahmen von Ihrer Seite unterstützt werden?
Die Antworten der Parteien:
CDU
Der hessische Justizvollzug verfolgt das Ziel der Resozialisierung von Strafgefangenen und stellt dafür ein umfassendes und individuelles Angebot zur Verfügung. Auch der offene Vollzug ist ein wichtiger Teil der hessischen Vollzugslandschaft. Vollzugsöffnende Maßnahmen dienen der Vorbereitung auf ein Leben in Freiheit und der Wiedereingliederung Inhaftierter in die Gesellschaft. Gerade bei Freiheitsstrafen von nicht mehr als zwei Jahren und bei Verurteilungen aufgrund von Straßenverkehrsdelikten kommt diese Praxis häufig zum Einsatz.
SPD
Wir werden uns für die verstärkte Nutzung des offenen Vollzugs bei erwachsenen Strafgefangenen einsetzen. Im Bereich jugendlicher Straftäter*innen sprechen wir uns für den offenen Vollzug als Regelvollzug aus. Erfahrungen aus Ländern, in denen diese Praxis im Jugendbereich bereits die Regel ist, zeigen, dass die Rückfallquoten jugendlicher Straftäter*innen dadurch deutlich reduziert werden können. Offener Vollzug jedoch bedarf auch einer notwendigen Rahmung, um erfolgreich zu sein: Strafgefangene mit langen Freiheitsstrafen müssen auf den offenen Vollzug vorbereitet werden, Kontakte der Haftanstalten nach „draußen“, etwa zu potentiellen Arbeitgebern, müssen aufgebaut und gepflegt werden. Hierzu bedarf es geschulten Personals sowohl im Bereich der Vollzugsbeamt*innen als auch im Bereich der Sozialarbeit. Zudem erscheint ein fachlicher Austausch mit anderen Bundesländern und Staaten über Praktiken und Erfahrungen mit offenem Vollzug gewinnbringend.
FDP
Der offene Vollzug ist nach Auffassung der Freien Demokraten zu intensivieren, um die Rückfallquoten zu reduzieren. Seitdem Zuständigkeit für den Strafvollzug mit Wirkung vom 1. September 2006 dem Bund weggenommen und den Ländern übertragen wurde, ist der Wohnsitz der Straftäter ausschlaggebend dafür, wie in der Haft mit ihnen umgegangen wird - ob die Resozialisierung oberstes Vollzugsziel ist oder die Sicherheit der Allgemeinheit. Die öffentliche Sicherheit muss stets gewährleistet sein. Dies steht auch für uns außer Frage. Im Jahr 2006 in einem Urteil ausgeführt, dass Resozialisierung den besten Schutz vor neuen Straftaten biete. Der Sicherheit der Allgemeinheit ist also am besten gedient, wenn die Resozialisierung funktioniert. Der offene Vollzug wiederum gilt als sehr resozialisierungsfreundlich, weil er den Gefangenen die Nähe zum Leben in Freiheit ermöglicht; die Rückfallquote von entlassenen Gefangenen, die im offenen Vollzug waren, ist deutlich geringer als die derjenigen im geschlossenen Vollzug. Weniger als ein Prozent der Inhaftierten missbraucht die Lockerungen. Dieser Gedanke muss sich auch in den hessischen Strafvollzugsgesetzen widerspiegeln. Daneben müssen die Begleitung der Gefangenen nach der Haftentlassung und die Vorbereitung zur Haftentlassung verbessert werden. Ansonsten kann Resozialisierung nicht gelingen.
- Stand Dezember 2022 waren lediglich 150 der 382 Plätze des offenen Vollzugs in Hessischen JVAen belegt. Dies entspricht einer Belegungsquote von 39,3%.
- Gründe für diese niedrige Zahl sind vielfältig – Der Leiter der JVA Dieburg sprach bspw. davon, dass Gefangene weniger verlässlich wären als früher, andere sprachen davon, dass die Nachwirkungen von Corona ein Grund für den Rückgang sei.
- Der Leiter der JVA Schwalmstadt meinte im Austausch mit LD, dass der Offene Vollzug vor allem das Problem habe, dass er zwar für die Gefangenen eine wichtige Chance ist, allerdings die Leiter „nichts davon hätten“ den Gefangenen diese Chance einzuräumen. Im Gegenteil – diese seien verantwortlich wenn ein Gefangener einen Fluchtversuch unternimmt.
DIE LINKE HESSEN
Siehe oben, wurde gemeinsam beantwortet mit dem Punkt:
Wiedereingliederung und Teilhabe
Der Landeszusammenschluss für Straffälligenhilfe in Hessen fragt zum Thema:
- Frauen als Klientinnen der Straffälligenhilfe
Frauen stellen im Strafvollzug eine Minderheit dar. Ihre Straftaten sind größtenteils im Bagatellbereich anzusiedeln, sie verbüßen meist nur Kurzstrafen. Sie sind häufiger als Männer Opfer von Gewalt und leiden unter körperlichen und psychischen Erkrankungen. Die Inhaftierung verarbeiten sie eher resignativ, oft führt dies zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands. Mit gendersensiblen Angeboten muss hier entgegengewirkt werden.
Inhaftierte Frauen sind häufig Mütter. Sofern das dem Kindeswohl nicht entgegensteht, muss die Bindung zwischen Mutter und Kind eine hohe Priorität erhalten, der Vollzug die letzte strafrechtliche Maßnahme sein. Sollte die Inhaftierung unvermeidbar sein, müssen Mütter und Kinder einen Anspruch auf eine Unterbringung in einem Mutter-Kind-Vollzug haben. Nach der Haft sind alleinerziehende Mütter und ihre Kinder besonders stark von Armut betroffen.
- Wie werden Sie sich für die Umsetzung eines gendersensiblen Strafvollzuges und dem Ausbau alternativer Sanktionen einsetzen?
Die Antworten der Parteien:
SPD
Siehe oben, wurde gemeinsam beantwortet mit dem Punkt
Familienorientierter Strafvollzug: Angehörige als Zielgruppe der Straffälligenhilfe
FDP
Gendersensibler Strafvollzug im Sinne einer getrennten Unterbringung von weiblichen und männlichen Gefangenen findet in Hessen statt. Bei Inhaftierten, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, muss im jeweiligen Einzelfalls über die Unterbringung entschieden werden. Nach unserer Kenntnis ist aktuell in Hessen keine Person diversen Geschlechts inhaftiert.
Mit einem Gesetz zur Überarbeitung des Sanktionenrechts geht unser Bundesjustizminister reformbedürftige Projekte im Strafgesetzbuch an. Damit sollen unter anderem die Möglichkeiten bekräftigt und ausbaut werden, durch ambulante Maßnahmen positiv auf Straftäter einzuwirken.
Ziel wird die Möglichkeit einer Therapieweisung im Rahmen der Strafaussetzung zur Bewährung (§ 56c StGB), der Verwarnung mit Strafvorbehalt (§ 59a StGB) und des Absehens von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen (§ 153a StPO) sein; aktuelle Studien zeigen nämlich, dass solche Therapien tatsächlich rückfallreduzierende Wirkung haben. Bei der Verwarnung mit Strafvorbehalt wird zusätzlich die Möglichkeit für sonstige Weisungen und für eine Auflage geschaffen, gemeinnützige Leistungen zu erbringen (Arbeitsauflage).
DIE LINKE HESSEN
Wir stehen für eine gute Sozialpolitik – das ist die beste Kriminalpolitik. Ziel ist es, möglichst die Delinquenz zu vermeiden und Strafvollzug als Ultima ratio zu begreifen. Klar ist aber auch, dass Strafvollzug auch gendersensibel sein muss. Frauen, bei denen es einen Zusammenhang zwischen ihrer Straffälligkeit und zuvor erlittenen Gewalterfahrungen gibt, kann beispielweise durch eine Traumatherapie geholfen werden, die für alle inhaftierten Frauen angeboten werden muss.
CDU
In Hessen findet bereits jetzt ein gendersensibler Strafvollzug statt. Weibliche und männliche Gefangene werden getrennt voneinander und damit gendersensibel untergebracht. Bei Personen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, erfolgt eine Unterbringung unter Würdigung des jeweiligen Einzelfalls. Zum Stichtag am 25. Juli 2022 war keine Person diversen Geschlechts in Hessen inhaftiert.
Der Landeszusammenschluss für Straffälligenhilfe in Hessen fragt zum Thema:
- Jugendliche und Heranwachsende
Bei jugendlicher Delinquenz ist der staatliche Eingriff möglichst gering zu halten, um schädliche Auswirkungen von Sanktionen auf Jugendliche und Heranwachsende zu vermeiden. So sollte bei Bagatelldelikten das Verfahren möglichst frühzeitig eingestellt und jugendberatenden Leistungen der Vorzug gegeben werden. Im Sinne der Diversion sollen statt strafrechtlicher besser erzieherische Maßnahmen ergriffen werden. Im Haus des Jugendrechts arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe und freie Träger lösungsorientiert und zeitnah zusammen. Eine gerade erschiene Studie zur Legalbewährung zeigt, dass die Rückfallquote derjenigen, die an einer jugendstrafrechtlichen Diversionsmaßnahme teilgenommen haben, um 70 Prozent sank.
- Was werden Sie dafür tun, um Häuser des Jugendrechts flächendeckend in Hessen zu installieren und mit genügend Mitteln auszustatten?
Die Antworten der Parteien:
FDP
Die Einrichtung weiterer Häuser des Jugendrechts wollen wir dort, wo es vor Ort sinnvoll und gewünscht ist, vorantreiben und mit den erforderlichen finanziellen Mitteln ausstatten. Die Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe unter Einbeziehung von freien Trägern unter einem Dach zusammen in den Häusern des Jugendrechts, um Jugendkriminalität effektiv und schnell zu bekämpfen und kriminelle Karrieren frühzeitig zu verhindern, hat sich aus Sicht der Freien Demokraten bewährt.
DIE LINKE HESSEN
Wir werden in der kommenden Legislatur darauf hinwirken, dass in Hessen flächendeckend die beteiligten Institutionen lokal gut funktionierende Kontakte und Strukturen der Zusammenarbeit etablieren. Ob die in einem „Haus des Jugendrechts“ oder in anderer Form geschieht ist an den Gegebenheiten vor Ort zu orientieren.
SPD
Wir wollen die Häuser des Jugendrechts, die auf Initiative der SPD erfolgreich in Hessen eingeführt wurden, auf weitere Standorte ausweiten und streben perspektivisch eine flächendeckende Einrichtung in ganz Hessen an. Seit Jahren setzen wir uns hierfür für ausreichende Mittel in den jeweiligen Justizhaushalten ein. Diese Mittel müssen so bemessen sein, dass die fortschreitende Ausweitung der Häuser des Jugendrechts auskömmlich zu finanzieren ist und ebenso Förderungen für Kommunen möglich sind – etwa wenn es darum geht, bisher virtuelle in reale Häuser des Jugendrechts umzugestalten.
CDU
Die CDU Hessen steht für eine konsequente Bekämpfung von Jugendkriminalität. Kriminelle Karrieren müssen frühzeitigverhindert werden. Hierzu bedarf es des effektiven Zusammenwirkens der auf Jugendkriminalität spezialisierten Einrichtungen. Die Häuser des Jugendrechts bieten genau dies. Die Häuser des Jugendrechts sind ein Erfolgsmodell und der Erfolg gibt uns Recht. Eine Studie der Kriminologischen Zentralstelle (KrimZ) hat im vergangenen Jahr am Beispiel des Hauses des Jugendrechts in Frankfurt-Höchst aufgezeigt, dass sich die Rückfallquote von jugendlichen Straftäterinnen und Straftätern bei der Bearbeitung der Verfahren durch ein Haus des Jugendrechts, deutlich reduziert hat.
Hessen verfügt bereits über sieben solcher Häuser. Ein weiteres Haus des Jugendrechts mit dem Schwerpunkt auf Prävention von Rechtsextremismus in Hanau, einem überaus wichtigen Standort, steht vor der Eröffnung.
Die CDU-geführte Landesregierung hat sich priorisiert dafür eingesetzt, die Häuser des Jugendrechts personell und finanziell mit den erforderlichen Mitteln auszustatten, um die Jugendkriminalität weiterhin effektiv zu bekämpfen.
Es ist das Ziel der CDU Hessen, das Netz an Häusern des Jugendrechts auszubauen und das Erfolgsmodell auch an weiteren Standorten inHessen zu starten.
Der Landeszusammenschluss für Straffälligenhilfe in Hessen fragt zum Thema:
- Digitalisierung im Strafvollzug
Inhaftierte im geschlossenen Vollzug sind von der Außenwelt abgeschirmt. Ihre Angelegenheiten hinsichtlich einer gelingenden Resozialisierung können sie nicht eigenverantwortlich und selbständig mitgestalten.
Die Nutzung digitaler und medialer Dienste und Angebote kann die Resozialisierung unterstützen und die digitale Kompetenz stärken. Dabei geht es für die Inhaftierten um Hilfe zur Selbsthilfe. Sie lernen, ihre behördlichen Angelegenheiten durch Eigeninitiative wieder selbständig zu regeln und zugleich Informationen zu Angeboten externer Hilfsorganisationen einzuholen und entsprechend Kontakt aufzunehmen.
- Haben Sie vor, flächendeckend einen (eingeschränkten) Internetzugang für Inhaftierte zu installieren?
- Welche Pläne bestehen, um die Insassen der Justizvollzugsanstalten intramural besser in der digitalen Erledigung behördlicher Anträge zu schulen?
Die Antworten der Parteien:
DIE LINKE HESSEN
Wir setzen uns seit langem dafür ein, Gefangenen einen (begrenzten) Internetzugang zu gewähren. Digitalisierung ist ein wichtiger Aspekt moderner Resozialisierung. Ein PC auf dem Haftraum, auch um Anliegen innerhalb der Anstalten digital zu stellen und so den digitalen Workflow zu erlernen, ist ebenso eine Forderung von uns.
CDU
Kommunikation nach „außen“ ist im Sinne des Resozialisierungsgedankens äußerst wichtig. Sie dient dazu, soziale Kontakte zu schaffen bzw. zu erhalten. Das Internet – insbesondere die Kommunikation via E-Mail – bietet grundsätzlich eine gute Möglichkeit zur Wahrnehmung solcher sozialen Kontakte.
In hessischen Justizvollzugsanstalten besteht die Möglichkeit der Kommunikation durch Besuche, Paketempfang, Schriftwechsel und Telekommunikation, hierunter insbesondere auch die Möglichkeit der Videotelefonie. Letztere wurde von der CDU-geführten Landesregierung in der Corona-Zeit etabliert und hat zu einer erheblichen Entlastung der psychischen Situation der Gefangenen beigetragen.
Die große Herausforderung besteht insbesondere darin, die Kommunikationswege tatsächlich und rechtlich so auszugestalten, dass sie nicht – z.B. zur Begehung von weiteren Straftaten – missbraucht werden können. Dies macht die Bereitstellung eines unregulierten Internetzugangs auf unserer Sicht nicht möglich.
Die CDU Hessen wird sich dafür einsetzen, die Kommunikationsmöglichkeiten im Interesse einer nachhaltigen Resozialisierung weiter zu optimieren. Denkbar wäre dies z.B. in Form einer flächendeckenden Einrichtung einer Kommunikationsmöglichkeit der Gefangenen via E-Mail, die die Sicherheitsaspekte angemessen berücksichtigt.
Bereits jetzt besteht zudem für Gefangene die Möglichkeit, eine Lernplattform für unterschiedliche Ausbildungsziele zu nutzen. Computer werden hierzu in einem abgesicherten Netzwerk betrieben und lediglich auf ausgewählte zugeschnittene Lerninhalte freigegeben.
SPD
Beim eingeschränkten Internetzugang im Strafvollzug werden wir Pilotprojekte, wie sie etwa in Berlin existieren, auswerten und prüfen, inwiefern sie sich auf Hessen übertragen lassen. Die Möglichkeit eines eingeschränkten Internetzugangs ist mit Sicherheitserfordernissen abzuwägen und durch diese begrenzt. Wir sehen im Internetzugang für Strafgefangene prinzipiell die Möglichkeit, Kontakte „nach draußen“, etwa zur Familie oder zu Behörden, zu erhalten bzw. aufzubauen. Begleitung und Schulung könnten durch Sozialarbeiter*innen erfolgen. Gerade bei der Erledigung von behördlichen Angelegenheiten, dürften dem Vorhaben jedoch durch die momentan eher rudimentären Möglichkeiten digitaler Verwaltungen Grenzen gesetzt sein.
FDP
Moderne Formen der Telekommunikation erweitern den Möglichkeitsrahmen der Gefangenen erheblich und dienen der Gesellschaft langfristig im Sinne einer mit größerer Wahrscheinlichkeit gelungenen Resozialisierung. E-Learning-Angebote sind geeignet, die Gefangenen an den Stand der Technik heranzuführen und mediale Kompetenzen der Strafgefangenen zu schulen. Sie halten die Gefangenen auf verschiedene Weise im Kontakt zur Außenwelt. Die Nutzung von Instant-Messaging-Diensten eröffnet etwa eine virtuelle Besuchsmöglichkeit (zum Beispiel für Kinder oder gebrechliche Menschen). Deshalb fordern wir, dass gerade auch die in der Pandemie geschaffenen Möglichkeiten weiterhin genutzt und ausgebaut werden. Die modernen Telekommunikationsmittel sollen den Gefangenen nicht ungehindert, sondern nur zu den vorgenannten sozial erwünschten Zwecken zur Verfügung stehen.
Der Landeszusammenschluss für Straffälligenhilfe in Hessen fragt zum Thema:
- Finanzierung der freien Straffälligenhilfe
Die Träger und Einrichtungen der Freien Straffälligenhilfe leisten einen notwendigen und großen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration und Resozialisierung von straffällig gewordenen Menschen. Ihre finanzielle Ausstattung ist jedoch unsicher und nicht ausreichend. Hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen müssen ausgebildet, angeleitet und supervidiert werden und ihre Arbeit muss koordiniert werden. Mehrheitlich erfolgt die Finanzierung durch die öffentliche Hand im Rahmen einer Projektförderung mit notwendigem Eigenanteil. Die Förderungen müssen meist jedes Jahr neu beantragt werden, mit der Folge, dass Monate ohne Geldzufluss überbrückt werden müssen. Die Eigenmittel müssen fast ausschließlich aus Geldbußenzuweisungen erbracht werden, da Spenden für die Straffälligenhilfe nicht zu generieren sind. Auch bei diesen konkurrieren die Vereine jedoch mit vielen anderen Organisationen.
- Welche Ansätze verfolgen Sie, um die Unterfinanzierung eines für die Sicherheit der Bevölkerung wichtigen sozialen Aufgabengebietes zu beheben?
- Unterstützt Ihre Partei Bestrebungen, die Landeshaushaltsordnung so zu gestalten, dass wichtige Aufgaben der Straffälligenhilfe kontinuierlich und angemessen gefördert werden können?
Die Antworten der Parteien:
CDU
Siehe oben, wurde gemeinsam beantwortet mit den Punkten
Wiedereingliederung und Teilhabe
Wohnraumsicherung und -bereitstellung als notwendige Voraussetzung der Wiedereingliederung von Inhaftierten und Haftentlassenen
SPD
Wir setzen uns für eine auskömmliche und kontinuierliche Finanzierung der freien Straffälligenhilfe ein. Die Dienste und Leistungen dieses Aufgabenbereichs müssen sich als feste Positionen im Haushalt wiederfinden, so dass sie in der Praxis dauerhaft – und nicht nur als Projekte – gesichert sind. Das dient mithin dazu, den Verwaltungsaufwand der Träger zu reduzieren (vergl.: Verwaltungsnachweise) und Kapazitäten für die eigentliche Arbeit frei zu machen. Die Finanzmittel müssen dabei so bemessen sein, dass die praktischen Aufgaben mit diesen auch abgedeckt werden können. Eine Änderung der Landeshaushaltsordnung zur Verstetigung und Absicherung der Dienste halten wir für wünschenswert und sinnvoll.
FDP
In Anbetracht der Wichtigkeit einer gut aufgestellten Straffälligenhilfe im umfassenden Sinne, die essentiell für die Wiedereingliederung und Resozialisierung von straffällig Gewordenen ist, werden wir uns dafür einsetzen, dass das Budget im Haushalt des Landes Hessen für derartige sozialpolitischen Maßnahmen nicht nur erhalten, sondern auch im notwendigen Umfang erhöht wird. Ein derartiges Engagement bedarf einer verlässlichen Planungs-und Zukunftssicherheit, um dieser Aufgabe gerecht werden zu können.
DIE LINKE HESSEN
Wir setzen uns dafür ein, die Straffälligenhilfe ausreichend und zuverlässig zu finanzieren.